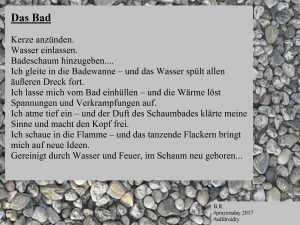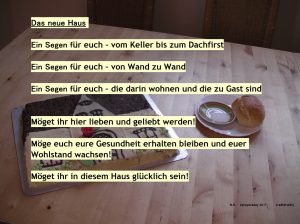Zu jener Zeit wanderten die die Götter noch oft über die Erde und lebten zwischen den Menschen. Taranis, der Donnernde, der Gott, der durch seine Regengüsse und Frühjahrsgewitter die Felder fruchtbar machte, streifte mit seinem Wagen umher und sah danach, dass alles seine Ordnung hatte.
Bei seiner Fahrt macht er einmal Halt in einem weiten Tal. Die Luft war mild, die Felder wurden langsam grün – Taranis war zufrieden.
Da ertönte ein Donnern und Brausen – und es stammte nicht von ihm! Überrascht und auch ein wenig verwirrt blickte er um sich.
In der Ferne, wo die Berge zu sehen waren, erhob sich im Flussbett eine hohe bräunliche Welle. Eine riesige Wasserwalze kam den Fluss herab und riss alles am Ufer mit sich. Zurück blieb ein schlammiger Sumpf, der weit über die Ufer des Flusses hinaus ins Land reichte. Gleichzeitig fielen orkanartige Regengüsse vom schwarz gewordenen Himmel.
Taranis runzelte verärgert die Stirn. Wo kam das her? Wer wagte es, dermaßen Chaos zu stiften und die Ordnung zu bedrohen? Er sprang in seinen Wagen und eilte durch die Sturmfront hindurch zum Himmel hinauf. Von hier oben hatte er einen besseren Überblick und da er ja selbst ein Sturmgott war, konnte ihm das Unwetter wenig anhaben.
Die Flutwelle war inzwischen weitergezogen und hatte weitere Landstriche verwüstet. Taranis sah, dass sie ihren Ursprung in den Bergen hatte, wo Schnee und Gletscher zu rasch geschmolzen waren und die Flüsse und Seen gefüllt hatten. Und er sah auch, wer dafür verantwortlich sein musste.
Dort, wo die Menschen mit ihren Äckern und Feldern nicht hinkamen, wo nicht mal mehr vereinzelt Almhütten standen, dort stand Cernunnos, sein alter Freund, und trommelte mit seinen Hufen, der der Grund bebte.
Taranis schüttelte besorgt den Kopf. War es wieder so weit? Cernunnos war der Herr der ungezähmten Natur, er hatte immer schon etwas Chaotisches, Unberechenbares an sich gehabt. Er herrschte auch über die Unterwelt und ihre Reiche des Todes. Gleichzeitig galt er als derjenige, von dem die Menschen sich Reichtum und Fruchtbarkeit erhofften. Während eines Großteils der Zeit war das auch so, doch gelegentlich zeigte sich Cernunnos von einer anderen Seite. Wie viele der Tiere, die ihm umgaben, gab es Zeiten, in denen er einen Wandel durchmachte und sich erneuerte. Und bis diese Wandlung vollzogen war, nahmen seine bedrohlichen Seiten aus alter Zeit zu und er wurde zu einer Gefahr für die Welt. Dann war er unruhig, unbeherrscht und zerstörerisch in seinem Wirken.
Der Donnergott nickte vor sich hin. Seine Aufgabe war es, Cernunnos durch diese Phase zu helfen und seine Kräfte in Schach zu halten. Rasch griff er nach seinem Blitzbündel und machte sich auf den Weg.
Cernunnos hörte das Donnern, als sich der Wagen näherte. Er verwandelte sich in einen Hirsch und floh in den Wald. Zwischen den hohen Kiefernstämmen war es für Taranis schwer, mit seinem Wagen durchzukommen. So spannte er sein Pferd aus, sprang auf dessen Rücken und nahm so die Verfolgung auf. Er warf mit einem Blitz nach dem anderen Gott, aber dieser war schon zu weit voraus, und der Blitz verfehlte das Ziel.
Cernunnos wähnte sich erst mal in Sicherheit. Sein Kopf mit dem Geweih juckte so fürchterlich, daher rieb er sich an einem dicken Stamm. Doch er hatte nicht mit Taranis’ Hartnäckigkeit gerechnet. Dieser war den Spuren gefolgt und seine Beute aufgespürt.
Cernunnos verwandelte sich erneut, diesmal in eine Schlange. So, glaubte er, könne er dem Gegner besser entgegentreten.
Taranis’ Pferd bäumte sich auf, als die riesige Schlange ihn umkreiste. Mehrfach versuchte der Donnergott seinen Gegner zu erwischen, aber Cernunnos wich immer wieder geschickt aus. Schließlich warf Taranis wieder einen Blitz, aber diesmal wandte er sich sofort in die Gegenrichtung – und Cernunnos hatte das Gleiche getan, um dem Blitz auszuweichen. So ritt Taranis mit voller Kraft über den mächtigen Schlangenkörper seines alten Freundes.
Cernunnos krümmte sich, aber die Hufe des Pferdes hatten gut gezielt und ihn fast betäubt. Mit letzter Kraft schälte er sich aus seiner Schlangenhaut und glitt in ein Loch in der Erde.
Der Orkan nahm ab und verwandelte sich in einen leichten, feinen Regen. Gleichzeitig erschien die Sonne hinter einigen Wolken und sandte zaghaft erste Strahlen zur Erde herab.
Taranis hob die zurückgebliebene Schlangenhaut auf und hob sie triumphierend über den Kopf. Die Schuppen schillerten in bunten Farben, rot, gelb, grün, blau. Der Donnergott warf sie in die Luft, wo sie hängen blieb und eine großen Bogen formte. Zufrieden betrachtete Taranis sein Werk:
„Bleib da unten, bis du wieder bei Sinnen bist!“, rief er Cernunnos zu. „In dieser Welt ist kein Platz für dein Chaos.“
So geschah es, und als die Flüsse letztlich wieder in ihre Betten zurückgekehrt waren, zeigte sich an vielen Orten, dass sie unerwartete Schätze an Land gespült hatten: Mancherorts war der Boden nun viel nährstoffreicher als vorher, an anderen Stellen waren Schiffswracks mitsamt ihrer verbliebenen Fracht zugänglich geworden und vereinzelt zeigte sich eine Goldader, wo vorher nur Stein gewesen war. So hatte sich Cernunnos doch noch als gewinnbringender Gott erwiesen.
Die Schlangenhaut blieb als Regenbogen der Erde erhalten, zum Zeichen dafür, dass die Ordnung das Chaos bezwungen hat.
Taranis aber kehrte zufrieden an den Himmel zurück.
Diese Geschichte ist von vorne bis hinten eine freie Schöpfung meinerseits. Für viele Kulturen gibt es den Mythos vom Kampf zwischen dem Donnergott und der Chaosschlange oder dem Drachen oder etwas Ähnlichem. Thor gegen die Midgardschlange, Indra gegen Agni, Perún gegen Veles – und bei den Galliern möglicherweise Taranis gegen irgendwen. Dass es sich dabei um Cernunnos handelt, ist meine Version, und sie funktioniert für mich nur, weil ich die Beziehung zwischen den beiden Kampfgegnern als eine freundschaftliche darstelle, eher eine Art Freundschaftsdienst als ein Kampf auf Leben und Tod.
Wahr ist, dass es Säulen gibt, auf denen ein Gott, der als Taranis/Jupiter identifiziert werden konnte, eine gigantische Gestalt mit Schlangenkörper niederreitet und besiegt. Wahr ist auch, dass der Gott Cernunnos als eine ambivalente Gottheit bezeichnet werden kann. Ceisiwr Serith hat dazu eine schöne Analyse geschrieben. Es gibt Geschichten, die Cernunnos über sein Geweih mit der Hirschgestalt in Verbindung bringen. Nirgendwo wird hingegen behauptet, dass Cernunnos sich in eine Schlange verwandeln kann. Er hält wohl eine Schlange in der Hand. Ich habe mir hier Elemente der slawischen Variante ausgeliehen. Wichtig war mir, dass Cernunnos nicht als der Bösewicht von Dienst erscheint, sondern das Chaos nur ein zeitweiser Aspekt seiner Persönlichkeit ist. Darum kann man ihn dennoch verehren und respektieren, und er kann mit Taranis befreundet sein. Was nun den Regenbogen betrifft, nun ja, das nordische Pantheon hat Bifröst, und mir kam die Idee, dass der Regenbogen für die Gallier bestimmt auch eine besondere Bedeutung gehabt haben muss.